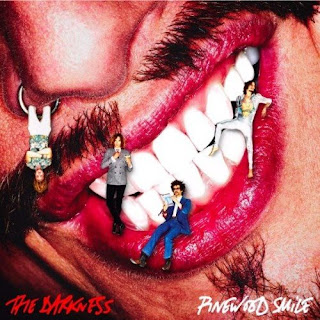Als Mensch, der kein Fleisch ißt, hat man es manchmal nicht leicht. Das heißt: Man hat es selbstverständlich schon leichter als die Menschen, die Fleisch essen, weil man gesünder, friedlicher und ohne das dräuende schlechte Gewissen lebt, das viele Fleischesser mit sich herumschleppen, die deswegen auch bei jeder Gelegenheit betonen und beteuern, sie wollten ab jetzt oder ganz bald auch endlich kein oder jedenfalls viel weniger Fleisch essen, wegen der Umwelt und den armen Tieren und weil das doch alles ein Wahnsinn sei, diese industrielle Massenhaltung und so.
Das bleibt einem erspart, allerdings nicht ein anderes schlechtes Gewissen, das einen zwangsläufig überkommt, wenn man all diese Schwüre und Beschwörungen über sich ergehen lassen muß, immer verbunden mit dem zerknirschten Geständnis, man sei halt noch nicht ganz so weit und könne sich hin und wieder (was in solchen Fällen heißt: immer) einfach nicht beherrschen, wenn einem Wammerl, Ripperl, Lüngerl, Sülzerl, Würstl, Backhendl oder Omas wunderbarer Schweinsbraten vorgesetzt werde.
Man könnte diesen Menschentyp den Überzeugungs-Beinahe-Vegetarier nennen: Tagtäglich studiert er Zeitungsartikel und glotzt Fernsehsendungen, in denen ihm erklärt wird, was für ein gigantischer Skandal die Fleischproduktion und -fresserei ist, geht in sich und gelobt ganz arg Besserung, bis ihm vom vielen Geloben und Selbstzerknirschen der Trotzkragen platzt. Dann pfeift er auf die Halden von Bio- und sonstiger Gutmenschnahrung im Kühlschrank, zieht los und stopft sich Hamburger und Currywurst in die Wampe, kippt einen Schnaps hinterher und stimmt im Überschwang der Seligkeit Tiraden auf die blöden Körnerfresser und Kohlrabiapostel an, die ihm seinen Lebensgenuß vergällen wollen. Die sollen gefälligst ihr Tofugematsche nicht „Wurst“ nennen, weil wir ihnen sonst aufs Dach steigen, und wenn schon, denn schon!
Am nächsten Tag schleichen die armen Sünder dann wieder schwer bratenverkatert durch die Gänge der Biosupermärkte, legen Kürbis, Pastinake und Urkorn in den Korb und informieren sich eifrig über die Unterschiede zwischen Quinoa und Chia. Und so geht das immer weiter, ein Teufelskreis der abwechselnden Selbstkasteiung und Entgrenzung, dessen Anblick so mitleiderregend ist, daß man ihnen am liebsten sagen täte, sie sollten sich doch nach Herzenslust ihr Schweinernes hineinhauen, damit man wenigstens die abwechselnd schuldbewußten und hochmütigen Gesichter nicht mehr anschauen muß.
Das bleibt einem erspart, allerdings nicht ein anderes schlechtes Gewissen, das einen zwangsläufig überkommt, wenn man all diese Schwüre und Beschwörungen über sich ergehen lassen muß, immer verbunden mit dem zerknirschten Geständnis, man sei halt noch nicht ganz so weit und könne sich hin und wieder (was in solchen Fällen heißt: immer) einfach nicht beherrschen, wenn einem Wammerl, Ripperl, Lüngerl, Sülzerl, Würstl, Backhendl oder Omas wunderbarer Schweinsbraten vorgesetzt werde.
Man könnte diesen Menschentyp den Überzeugungs-Beinahe-Vegetarier nennen: Tagtäglich studiert er Zeitungsartikel und glotzt Fernsehsendungen, in denen ihm erklärt wird, was für ein gigantischer Skandal die Fleischproduktion und -fresserei ist, geht in sich und gelobt ganz arg Besserung, bis ihm vom vielen Geloben und Selbstzerknirschen der Trotzkragen platzt. Dann pfeift er auf die Halden von Bio- und sonstiger Gutmenschnahrung im Kühlschrank, zieht los und stopft sich Hamburger und Currywurst in die Wampe, kippt einen Schnaps hinterher und stimmt im Überschwang der Seligkeit Tiraden auf die blöden Körnerfresser und Kohlrabiapostel an, die ihm seinen Lebensgenuß vergällen wollen. Die sollen gefälligst ihr Tofugematsche nicht „Wurst“ nennen, weil wir ihnen sonst aufs Dach steigen, und wenn schon, denn schon!
Am nächsten Tag schleichen die armen Sünder dann wieder schwer bratenverkatert durch die Gänge der Biosupermärkte, legen Kürbis, Pastinake und Urkorn in den Korb und informieren sich eifrig über die Unterschiede zwischen Quinoa und Chia. Und so geht das immer weiter, ein Teufelskreis der abwechselnden Selbstkasteiung und Entgrenzung, dessen Anblick so mitleiderregend ist, daß man ihnen am liebsten sagen täte, sie sollten sich doch nach Herzenslust ihr Schweinernes hineinhauen, damit man wenigstens die abwechselnd schuldbewußten und hochmütigen Gesichter nicht mehr anschauen muß.
Es ist eine seltsame Geschichte mit dem Menschen und seinem Fleisch, das ihm so irre gut schmeckt, zumindest wenn es kein Gesicht hat und nicht mehr als süßes Tier erkennbar ist, von dem er aber gleichzeitig weiß, daß es einmal ein Gesicht und ein Leben und alles mögliche hatte, was er auch hat. Zum Beispiel hat mir noch nie jemand schlüssig erklären können, weshalb man ein Schwein selbst als Ferkelkind jederzeit verzehren kann, einen rein äußerlich (zumindest im gebratenen Zustand) sehr ähnlichen Hund jedoch keinesfalls. Oder eine Katze: freilich, die ist putzig, pelzig und possierlich, aber gilt das für Kaninchen etwa nicht?
Dann kommt die Sache mit dem Schlachten ins Spiel, das offenbar ein derart obszöner Vorgang ist, daß niemand was damit zu tun haben will (außer er leidet an komplett durchgeknalltem Midlife-Machismus und frißt sein Tier am liebsten roh, wenn nicht lebendig). Wieso können empfindliche Gemüter, wenn sie Zeuge der Tötung eines Huhns werden, die daraus produzierte Hühnersuppe nicht mehr genießen (oder frühestens drei Tage später)?
Zufällig meldet gerade heute die Boulevardpresse einen ungeheuerlichen Vorgang: Ein Metzger in einem Schweizer Dorf hatte angekündigt, er wolle „dem Publikum sein traditionelles Handwerk nahebringen“ und werde zu diesem Zweck auf offener Straße zwei Säue schlachten. Offenbar war sein Dorf nicht einstimmig gewillt, sich so etwas nahebringen zu lassen: Der örtliche Pfarrer protestierte ebenso wie Tierschützer, denen jedoch nicht etwa der Schutz der Tiere am Herzen lag, sondern vielmehr das Seelenheil der Fleischesser – nämlich wurde nicht der Mord an zwei fröhlichen Zeitgenossinnen bemängelt, sondern dessen öffentliche Aufführung. „Öffentlich darf eine solche Gewalt nicht gezeigt werden“, mahnte der Pfarrer. In Drohbriefen mußte sich der wackere Fleischhandwerksmann gar sagen lassen, er sei auch nicht besser als das Terroristengeschwerl vom IS, das ebenfalls öffentlich töte.
Immerhin „einige Dutzend Zuschauer“ wollten dann doch sehen, wie die „Schlachtung samt Zerteilung vollzogen“ wurde. Photographieren und Filmen durften sie allerdings nicht. Am Ende wären die grausen Clips als Selfie mit Darm o. ä. auf Instagram gelandet – nicht auszudenken, welche Auswirkungen das auf die Eßmoral gehabt hätte, als man sich hinterher in einem Festzelt versammelte, um schlachtfrische Blut- und Leberwürste zu verzehren. Aber glotzen, Blut spritzen sehen und ein letztes Gurgeln hören wollte man halt doch, vorher.
Zufällig fand sich in demselben Boulevardblatt die folgende „Meldung“: „Worüber unterhielten sich Vater und Mutter, der Sohn und seine Ehefrau in dem BMW X3? Waren sie vergnügt, oder fielen in dem schweren SUV laute Worte? Was hatten die vier Familienmitglieder vor, wenn sie ihr Ziel in Rosenheim erreicht haben würden? Was führte schließlich zu dem schweren Unfall auf der Autobahn A8 in der Nähe von Irschenberg? Auskunft wird nur der Vater geben können, wenn er von seinen schweren Verletzungen genesen ist. Denn die drei anderen Insassen des Autos sind tot – gestorben am Sonntagnachmittag an einem Baum, gegen den der BMW gekracht ist.“
Ich ahne, daß irgendwo in diesem widerwärtig schmalzig-seimigen Salm ein Indiz verborgen ist, um die Mixtur aus Verdrängung und Verfettung, Todesangst und Mordlust, Gaff- und Freßgier zu erklären, die den modernen Menschen nicht nur am Eßtisch plagt. Aber darüber weiter nachzudenken, fiele mir schwerer als eine rohe Rinderniere zu verzehren.
Die Kolumne "Belästigungen" erscheint alle vierzehn Tage im Stadtmagazin IN MÜNCHEN.
Dann kommt die Sache mit dem Schlachten ins Spiel, das offenbar ein derart obszöner Vorgang ist, daß niemand was damit zu tun haben will (außer er leidet an komplett durchgeknalltem Midlife-Machismus und frißt sein Tier am liebsten roh, wenn nicht lebendig). Wieso können empfindliche Gemüter, wenn sie Zeuge der Tötung eines Huhns werden, die daraus produzierte Hühnersuppe nicht mehr genießen (oder frühestens drei Tage später)?
Zufällig meldet gerade heute die Boulevardpresse einen ungeheuerlichen Vorgang: Ein Metzger in einem Schweizer Dorf hatte angekündigt, er wolle „dem Publikum sein traditionelles Handwerk nahebringen“ und werde zu diesem Zweck auf offener Straße zwei Säue schlachten. Offenbar war sein Dorf nicht einstimmig gewillt, sich so etwas nahebringen zu lassen: Der örtliche Pfarrer protestierte ebenso wie Tierschützer, denen jedoch nicht etwa der Schutz der Tiere am Herzen lag, sondern vielmehr das Seelenheil der Fleischesser – nämlich wurde nicht der Mord an zwei fröhlichen Zeitgenossinnen bemängelt, sondern dessen öffentliche Aufführung. „Öffentlich darf eine solche Gewalt nicht gezeigt werden“, mahnte der Pfarrer. In Drohbriefen mußte sich der wackere Fleischhandwerksmann gar sagen lassen, er sei auch nicht besser als das Terroristengeschwerl vom IS, das ebenfalls öffentlich töte.
Immerhin „einige Dutzend Zuschauer“ wollten dann doch sehen, wie die „Schlachtung samt Zerteilung vollzogen“ wurde. Photographieren und Filmen durften sie allerdings nicht. Am Ende wären die grausen Clips als Selfie mit Darm o. ä. auf Instagram gelandet – nicht auszudenken, welche Auswirkungen das auf die Eßmoral gehabt hätte, als man sich hinterher in einem Festzelt versammelte, um schlachtfrische Blut- und Leberwürste zu verzehren. Aber glotzen, Blut spritzen sehen und ein letztes Gurgeln hören wollte man halt doch, vorher.
Zufällig fand sich in demselben Boulevardblatt die folgende „Meldung“: „Worüber unterhielten sich Vater und Mutter, der Sohn und seine Ehefrau in dem BMW X3? Waren sie vergnügt, oder fielen in dem schweren SUV laute Worte? Was hatten die vier Familienmitglieder vor, wenn sie ihr Ziel in Rosenheim erreicht haben würden? Was führte schließlich zu dem schweren Unfall auf der Autobahn A8 in der Nähe von Irschenberg? Auskunft wird nur der Vater geben können, wenn er von seinen schweren Verletzungen genesen ist. Denn die drei anderen Insassen des Autos sind tot – gestorben am Sonntagnachmittag an einem Baum, gegen den der BMW gekracht ist.“
Ich ahne, daß irgendwo in diesem widerwärtig schmalzig-seimigen Salm ein Indiz verborgen ist, um die Mixtur aus Verdrängung und Verfettung, Todesangst und Mordlust, Gaff- und Freßgier zu erklären, die den modernen Menschen nicht nur am Eßtisch plagt. Aber darüber weiter nachzudenken, fiele mir schwerer als eine rohe Rinderniere zu verzehren.
Die Kolumne "Belästigungen" erscheint alle vierzehn Tage im Stadtmagazin IN MÜNCHEN.