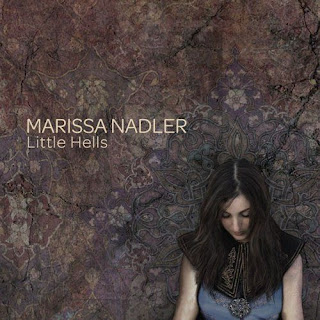F hat
mir erzählt, wie sie neulich über ihren Schatten gesprungen ist, der in diesem
Fall allerdings weniger ihr eigener war als der einer kollektiven Verblödung,
der wir alle manchmal verfallen. Sie habe eines ansonsten normalen Abends diesen
Typen in der Kneipe gesehen und gespürt, wie ihr ganz seltsam wurde, und sofort
seien die üblichen Gedanken durch ihr Hirn paradiert wie eine Schafherde über
den Steg: Mal sehen, was er sagt/tut/ob er was sagt/tut. Ach, wie gerne würde
ich. Wird sich schon ergeben, wenn/falls. Gerade noch rechtzeitig vor „wäre
wahrscheinlich sowieso nicht“ habe sie die Bremse gezogen, sei einfach
hingegangen und habe irgendwas absolut Saudummes gesagt, für das man sich im
normalen Leben unter den Tisch und durch die Bodendielen hindurch in die
Schwabinger Kanalisation hinunterschämen müßte. Was aber in diesem Fall – wie
in jedem Fall – genau das Richtige war: Er sagte irgendwas noch Saudümmeres,
und nach zwei Minuten war eines dieser Gespräche im Gang, aus denen die größten
Popsongs aller Zeiten entstanden sind.
Aber
dann seien die Probleme losgegangen: Zwar habe er sie angemessen stürmisch geküßt,
zwar habe sie den belanglosen Gesprächsinhalt in der Erinnerung längst durch
ein ausufernd wild erotisches Spiel von Blicken und stummen Provokationen
ersetzt, indes mußte er am nächsten Tag beruflich bedingt, wie man so sagt, „früh
raus“ und deshalb gehen, und nun korrespondiere sie zweimal täglich mit ihm über
Facebook, um zu erfahren, wieso eine körperliche Begegnung einfach nicht
zustande kommen will: Er kann nur, wenn sie nicht kann, und umgekehrt – alles mögliche
Berufliche und metaberuflich Soziale steht dazwischen, und derweil ziehe der
Sommer dahin und verfliege langsam, aber ebenso unaufhaltsam ihre aus der
verschwimmenden Erinnerung gespeiste Lust.
Ich
wollte nicht allzu belehrend wirken und beschränkte meine Ausführungen daher
auf die Standardbinsenweisheit, so gehe es eben, wenn der Mensch auf den grundlegenden
und ihn von allen anderen Lebewesen scheidenden evolutionären Defekt seines
Hirns hereinfalle: Dann habe er keine Gegenwart mehr, sondern nur noch eine „Zukunft“,
keine Liebe, sondern nur noch „Aussichten“ und „Optionen“, kein Geld, sondern
nur noch Zinsen, keine Zeit, sondern nur noch Termine, keine Leidenschaft,
sondern nur noch Ziele und Hoffnungen, und da es eine Zukunft nicht gibt, werde
all das irgendwann, spätestens mit Einsetzen der naturbedingten Demenz,
unbemerkt verschwinden und in Reue und Verzweiflung ertrinken.
All
das wußte F längst selber, und deswegen nickte sie nur melancholisch, weil er
es wahrscheinlich auch weiß und aber wie die meisten Menschen aus diesem Wissen
nur den Entschluß zieht, „irgendwann“ oder „bald“ was zu ändern, einen Schlußstrich
zu ziehen, dies und das „umzukrempeln“, einen „Neustart“ zu machen usw. Dazu,
das wissen wir auch alle, kommt es nie. Weil es das unablässige Tun des
Menschen ist, was einer Veränderung im Weg steht, kann man nichts verändern,
indem man etwas tut, sondern nur indem man etwas nicht tut.
Also
rief F ihren sogenannten Arbeitgeber an, erzählte ihm was von einer
Sommergrippe, und während wir solcherart von lästigen Pflichten befreit müßig
durch den Sommer radelten und den schimmernden Taumel genossen, den die
Mischung aus absoluter Ziellosigkeit, Münchner Luft und Mittagsbier erzeugt, während
wir mit der Isar flossen, über die Auer Dult flanierten, dem Rauschen der Bäume
lauschten, unseren Blick im Himmel verdunsten ließen und die Zeit vergaßen (die
übrigens sofort das Vergehen einstellt, wenn man sie vergißt), während wir
lachten und Blödsinn redeten und Menschen und Tieren bei ihren sinn- und
zwecklos lustigen Verrichtungen und Vergeblichkeiten zusahen, merkte ich, wie ihre
Trauer sich in Nichts auflöste, so wie sich bei den anderen Menschen das beglückende
Nichts in Trauer auflöst, wenn sie es mit Sinn und Zweck und Plänen zu füllen
trachten.
Während
nun ich den Vorsatz, nicht belehrend zu wirken, im zweiten Bier ertränkte und
munter mit Binsenweisheiten um mich warf, daß es nur so staubte, schenkte mir F
die beglückende Art von Blick, die man jemandem schenkt, der sich aufgrund
einer Überdosis absoluter Ziellosigkeit, Münchner Luft und Mittagsbier in einen
Guru zu verwandeln wähnt, und weil ich das selber wußte und merkte,
entschwanden wir für einen endlosen Augenblick in jener fernen Dimension, in
der sich so jemand tatsächlich in einen Guru verwandelt und das Lustigste tut,
was man im Leben tun kann: das eigene Spiegelbild in den Augen eines anderen
Menschen verspotten.
Aber
dann klingelt das Telephon, und die Redakteure rufen an: „Sailer, wo bleibt
dein verdammter Text! Wir sind eine Tageszeitung und keine Jahresschrift!“ Und
weil solche Gespinste wie das, in das wir uns eingesponnen hatten, an einem
winzigen Riß leicht gänzlich zerfasern, fällt F ein, daß sie noch ein Referat
vorbereiten und zum Sport und nach Berlin zum Geburtstag ihrer Oma und dies und
das muß.
Und während
der Sommer vergeht und wir zweimal täglich über Facebook korrespondieren und
Termine zu vereinbaren versuchen, ahne oder weiß ich, daß wir uns irgendwann
vielleicht wiedersehen werden, sporadisch hier und da, daß unser Sommer dann
aber vergangen und das beglückende Nichts in immerhin sanfter Trauer ertrunken
sein wird, über die wir vielleicht sogar irgendwann mal gemeinsam lächeln können.
Die Kolumne "Belästigungen" erscheint alle 14 Tage im Stadtmagazin IN MÜNCHEN.